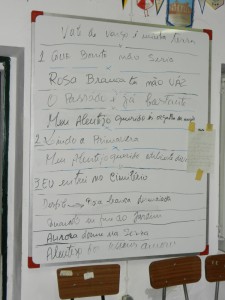31.08.2012
Salamanca – Barcelona – Madetswil 12. – 26. August 2012
Salamanca – Avila 103 km Mietauto
Avila – Toledo 139 km Mietauto
Toledo – Cuena 188 km Mietauto
Cuenca – Teruel – Alcaniz – Cambril 437 km Mietauto
Cambril – Montbrio del Camp – Taragona
– Montbrio del Camp 41 km Mietauto
Montbrio del Camp – Barcelona 132 km Mietauto
Barcelona – Madetswil 1075 km Zug
Nach der Millimeterarbeit in der Tiefgarage, suchten wir wie immer, die richtige Strasse um aus Salamanca heraus zu kommen. Bei einer Signalanlage, die auf Rot stand, leicht am Hang, stand vor uns ein VW Golf, darinnen zwei blutjunge Burschen. Als die Anlage auf Grün wechselte, wäre „Anfahren am Berg“ gefragt gewesen. Der Fahrer war nicht im Stande, den Wagen zu starten und sah hilflos in den Rückspiegel. Nach einer Weile Warten und Geduld, machte Armin ein Überholmanöver. Im selben Moment startete auch der VW, fuhr unkontrolliert los und Wups: Es kam zu einer Streifkollision. Die beiden Schnösel sahen ziemlich übernächtigt aus, sie waren kreidebleich und schlotterten. Wahrscheinlich waren sie auf dem Heimweg von der Samstagsparty. Sie wollten das Ganze auf einfache Art lösen, Armin aber verlangte einen Polizeirapport – als Ausländer mit einem Mietauto. Der eine telefonierte dann seiner Mutti und versuchte uns klar zu machen, dass sie bei der Polizei arbeite. Ob sie wirklich dort arbeitet? Als dann zwei richtige Polizeiautos , mit allem Drum und Dran bei uns eintrafen, hielt sie sich jedenfalls im Hintergrund. Als alles geregelt und die Papiere ausgefüllt waren, machten sich alle drei aus dem Staub, ohne ein Adios oder Perdon. Die Mutti chauffierte die zwei Buben nach Hause. Wir fragten die Polizisten nach dem Weg um nach Avila zu gelangen. Sie boten sich an, uns aus der Stadt zu begleiten. Die Polizei dein Freund und Helfer! Mit einer Polizeiescorte verliessen wir mit etwas Verspätung Salamanca.
Fazit: Autofahren ist viel gefährlicher als Velofahren!
Während dieses Zwischenfalls waren unsere Adrenalinspiegel auf Höchstmarke gestiegen. Das war wahrlich des Guten zuviel.
Mit der Fahrt nach Avila verliessen wir die Via de la Plata bereits wieder und fuhren Richtung Osten zu einem weiteren Weltkulturerbe. Wenn man auf die Stadt zu fährt, ist sie schon von weitem zu erkennen. Sie liegt auf einem Hügel und ist von einem 2,5 km langen Bollwerk von Festungsmauer umgeben. 88 Wachttürme schützten einst die Stadt.
300 Jahre lang wechselten sich Muslime und Christen regelmässig mit der Herrschaft ab, bis schliesslich die Christen endgültig das Ruder übernahmen.
Avila ist verkehrsmässig an das spanische Eisenbahnnetz angebunden und verfügt über einen beachtlichen Bahnhof. Wir nutzten diese Gelegenheit und liessen uns 2 Plätze im Euro-Night-Zug von Barcelona nach Zürich, für den 26. August reservieren. Unverhofft einfach lief dieses Prozedere ab.
Beim Bummel durch die Altstadt trafen wir auf eine Ausstellung verschiedenster Künstler. Aus allen Regionen Spaniens wurde schönes Kunsthandwerk zum Kauf angeboten, geschmackvolle Lederartikel, Schmuck, Holzwaren etc. Anhand der Preise musste es sich um sehr renommierte Künstler gehandelt haben.
Nun jagen wir von einem Weltkulturerbe zum Anderen.
Heute war es Toledo. Diese Stadt liegt südlich von Madrid und kann von dort aus einfach als Tagesausflug besucht werden. Toledo trägt nicht umsonst den Titel „La ciudad imperial“, die Königsstadt. Mit ihren Synagogen,
Kirchen,
einer bescheidenen Moschee und den Museen ist sie das kulturelle Zentrum Spaniens, sozusagen das Rom der iberischen Halbinsel. Dazu kommt noch die atemberaubende Lage auf einem felsigen Hügel, hoch über dem Rio Tajo.
Seit Jahrhunderten ist Toledo bekannt für die Qualität, der hier hergestellten Schwerter und Messer. Sie werden auch überall verkauft. Armin konnte seinem Sammlertrieb nicht widerstehen und seine Messersammlung ist um ein weiteres kunstgefertigtes Stück grösser geworden. Ein weiterer Bestseller ist alles, was mit „“Damasquinado“ zusammen hängt. Es ist ein altes arabisches Kunsthandwerk. Metall wird mit einem Messer aufgeraut. Anschliessend wird es mit feinen Gold- oder Silberfäden verziert und angepresst. Am Schluss kommen die Stücke in einen Ofen, damit sich die Metalle zusammen verschmelzen. Schmuckstücke aller Art, Teller, Brieföffner etc. werden mit dieser Technik in fast jedem Laden verkauft. Marzipan steht ebenfalls auf der Bestsellerliste. Sogar die Nonnen beteiligen sich an diesem süssen Geschäft.
Bei unserer Ankunft in der Stadt, am späten Vormittag, war schon einiges los und die Strassen sehr belebt. Am Abend aber, als die Geschäfte ihre Türen geschlossen hatten, wirkte sie wie ausgestorben.
Heute vernahmen wir, dass unsere Räder immer noch in Spanien sind und nicht über die Grenze transportiert werden können, da eine Passkopie von uns fehle. Gemäss Transportfirma akzeptiere der Zoll keine Kopie der Idenditätskarte. Mühsam erklärten wir der freundlichen Dame, dass wir erstens keinen Pass haben und zweitens diesen auch nicht benötigen, da wir in ganz Europa mit der Idenditätskarte umherreisen können. Sie hatte ein grosses Aha-Erlebnis und meinte sie würde das mit den Zollbeamten klären. In Algeciras, beim Transporteur mussten wir zwar die ID-Nummer angeben, aber die hübschen und sexy Damen hatten es unterlassen, von der Karte eine Kopie zu machen. Wir fotografierten die ID-Karte auf beiden Seiten und schickten diese Angaben per E-Mail. Nun sind wir gespannt, wer zuerst zu Hause ist, wir oder die Räder?
Eigentlich wäre Madrid auch auf unserer Reiseroute gestanden. Wir hatten jedoch überhaupt keine Lust, mit dem Auto in diese Grossstadt zu fahren. Mit dem Velo wären wir irgendwo in einen Regionalzug gestiegen und hätten uns direkt ins Zentrum fahren lassen. So beschlossen wir, uns diese Stadt zu einem späteren Zeitpunkt, in Form einer Städtereise, zu besichtigen. Wir fuhren gleich weiter, zum nächsten Weltkulturerbe, Cuenca.
Die Umgebung von Cuenca ist ein stark bewaldetes und fruchtbares Gebiet, mit zerklüfteten Bergen.
Zwei Flüsse sorgen dafür, dass die Felder auch im August saftig grün sind, der Rio Huécar und der Rio Jucar. Nach so viel ebenem Land, abgemähten und goldenen Weizenfeldern, tat der Anblick von zwar verblühten, aber doch noch grünen Sonnenblumenfeldern und Wälder richtig gut. Auch Cuenca ist sensationell gelegen, auf einer Hügelzunge zwischen den beiden genannten Flüssen. Wie aus einem Canyon ragt die Stadt hervor. Das Wahrzeichen dieses Ortes, sind die hängenden Häuser, die an den tiefen Schluchten kleben, die die Stadt umgeben.
Eine grosse Kathedrale und viele Museen fehlen ebenfalls nicht.
Wie in Toledo, ist auch hier nicht mehr viel aus muslimischer Zeit übrig geblieben. Beeindruckend war der Spaziergang, rund um die Stadt, hoch über den Felsen.
Auf den letzten 400 km Richtung Mittelmeerküste lernten wir ein weiteres Kapitel von Spaniens Vielfalt kennen. Es sind keine historischen Bauwerke mehr, sondern die Natur. Mit dem Fahrrad hätte dieser Abschnitt nochmals einiges von uns gefordert. Zwar waren die Strassen gut, nicht zu stark befahren, die Topografie hätten wir auch gemeistert. Aber die erste Unterkunft sahen wir nach 109 km. Ohne Zelt wären wir verloren gewesen.
Nach Cuenca ging es grün, hügelig und abwechslungsreich weiter. Kurz vor Teruel wurden wir von wunderschönen, roten Steinformationen überrascht.
Doch nach Teruel war die Landschaft wieder kahl, öd und steinig und hatte trotzdem einen ganz besonderen Reiz.
Zwischen den Steinen wurden Getreideäcker angelegt. Äcker, die nicht mit grossen Maschinen bearbeitet werden können. Wie es aussieht, mussten diese Felder erst in mühsamer Arbeit von den Steinen gesäubert werden. Halbverfallene Bahnhöfe zeugen davon, dass hier einmal eine Eisenbahn fuhr.
Stillgelegte Bergwerke sind heute nur noch Museen.
Die wenigen kleinen Dörfer sind an die Berge geklebt, nur sind sie nicht weiss, wie in Andalusien, sondern grau-braun, wie getarnt in der Farbe der Erde.
Dann wechselte das Landschaftsbild wieder, liebliche Täler mit Oliven- und Mandelbäumen.
Da uns keine grossen, historischen Orte mehr auf uns warteten, beschlossen wir, direkt an die Mittelmeerküste zu fahren, um dort noch einige Tage auszuspannen, bevor wir die letzte Stadt unserer Reise, Barcelona, besuchen werden. Am liebsten wäre uns ein kleines Familienhotel, mit Swimmingpool, bequemen Liegestühlen und Sonnenschirm gewesen. Wir steckten unsere Köpfe über die Landkarte, um herauszufinden, welcher Ort sich wohl für unsere Wünsche eignen würde. Cambrils? Diesen Namen hatten wir doch schon oft zu Hause in Reiseprospekten gelesen. Dort angekommen, war unser Traum bald zerschlagen. Alles ausgebucht! Ist ja klar, es herrscht ja Finanzkrise (?). In einer Pension, ohne Parkplatz, fanden wir schliesslich doch noch ein Zimmer für eine Nacht, damit wir wenigstens liegen konnten. Bei der Parkplatzsuche war das Glück auf unserer Seite.
Erst mussten wir uns an das feuchtwarme Waschküchenklima gewöhnen. Die Städte Salamanca, Avila, Toledo und Cuenca liegen alle auf einer Höhe zwischen 800 – 1100 m über Meer. Dort war die Luft trocken und die Temperaturen angenehm.
Am anderen Morgen packten wir unsere sieben Sachen wieder zusammen und machten uns erneut auf die Suche nach einem Hotel unserer Wünsche. Wir wurden denn auch bald fündig. Im Internet wurden wir auf einen Ort aufmerksam gemacht, der ca. 6 km in Landesinneren, gleich hinter Cambrils liegt, Montbrio del Camp. Dort gibt es ein Wellness- und Thermenhotel, das noch freie Zimmer hatte. Zwar ist es kein kleines Familienhotel, hat aber einen grossen, kostenlosen Parkplatz, eine wunderschöne Gartenanlage mit plätschernden Brunnen, schattenspendenden Bäumen, Swimmingpool, Liegestühlen und Wellnessanlage. Es fehlte nur noch der Kurschatten!
Wir merkten bald, dass das Ausspannen auf einem Liegestuhl , unter einem Sonnenschirm, am Pool keine einfache Sache ist und man erst um die gewünschten Utensilien und Orte kämpfen muss . Der Swimmingpool und die dazugehörige Umgebung wird erst um 11:00 h morgens geöffnet. Wenn man erst um 11:15 h kommt, sind alle Liegestühle unter den Bäumen und unter den Sonnenschirmen bereits mit einem Frotteetuch belegt, das heisst besetzt. Wir hatten jedoch das Glück, dass wir uns trotzdem noch zwei Liegestühle, samt Schirm ergattern konnten. Besonders den Schirm mussten wir hüten, damit er nach unserem Bad, nicht plötzlich bei einem anderen Liegestuhl stand. Während Stunden sah man niemanden auf den mit Badetüchern belegten Stühlen liegen, Hauptsache reserviert. Einige Schlaumeier steigen gar vor 11:00 h über den Gartenzaun und deponieren ihre Tücher, damit sie sich ganz sicher an die Sonne legen können. Es war also auch nicht möglich, früh morgens vor dem Frühstück, einige Runden alleine, ohne Gekreisch, zu schwimmen. Zum Glück mussten wir in den letzten 4 Monaten nicht ums Velo kämpfen.
Unsere strapazierten Füsse hatten dringend eine Pflege nötig, nach so viel Velofahren und Fussmärschen. Also war doch ein Peeling mit Zucker und Zitronen, anschliessend eine Maske mit weissem Tee und Orchideen, und schliesslich einsalben mit Avocadocreme genau das Richtige für sie und im Hotel wurde diese wunderbare Behandlung angeboten.
Das Faulenzen war nicht unser Ding und bald konnten wir nicht mehr ruhig sitzen. So machten wir einige Ausflüge in der näheren Umgebung. Als erstes fuhren wir nochmals nach Cambrils. Die Touristen sprechen meist Spanisch, Französisch und Russisch. Selbst Speisekarten und Hotelprospekte sind in Russisch geschrieben.
Wir badeten unsere Füsse im warmen Mittelmeer. Morgens um 11:00 h war die erste Reihe am Strand schon voll besetzt.
Sardine an Sardine! Zwar waren es nicht junge Paare mit Kindern, die Sandburgen bauen,
sondern meist Senioren, die sich gerne als Sardinas fritas fühlen. Wir setzten uns eine Weile auf eine Bank an der Strandpromenade, um unsere Füsse zu trocknen und beobachteten das Treiben am Strand. Liegestühle, Sonnenschirme und Kühltaschen wurden angeschleppt. Wir konnten uns für diese Playa nicht so richtig begeistern, wir sind wählerisch geworden. Zuviele schöne Strände sahen wir an der Atlantikküste.
Als zweites besuchten wir das ca. 25 km entfernte Tarragona. Für die römischen Ruinen konnten wir uns nicht mehr so ganz begeistern. Es scheint, als wären wir etwas gesättigt.

Zum Abschluss unserer Wohlfühltage fuhren wir noch einige Kilometer ins Hinterland, in die Hügel, zum Castell-Monastir de Sant Miquel d’Escornalbou. Hoch oben auf einer Bergspitze liegt dieses verlassene Kloster, mit einer herrlichen Rundsicht auf die umliegenden Berge.
Gott allein weiss, was einst die Leute dazu bewegte, in dieser verlassenen und steilen Gegend ein Kloster zu bauen. Die Strasse dort hinauf wies eine Steigung von 16 – 18 % aus. Wie es aussah, ist es für manche Velofahrer eine ehrgeizige Herausforderung, dort hinauf zu kriechen. Nur wir waren die Unsportlichen die mit dem Auto hinauffuhren und wurden von schlechtem Gewissen geplagt.
Wieder unten im Tal, besuchten wir den Parque Sama, der nur wenige Kilometer vom Hotel entfernt liegt. Der Park wurde Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Der Besitzer war ein Nachkomme, einer in Kuba lebenden Familie. Hier, zwischen Haselnuss-, Mandel-, Aprikosen-, Oliven- und Weinfeldern wollte er eine exotische Atmosphäre der verlorenen Kolonie bringen. Bis zum spanischen Bürgerkrieg gab es auch noch einen Zoo. Heute findet man noch 10 Papageien in einem Haus. Mitten im Park gelangt man an einen idyllischen See, mit Inseln, Brücken, einem Kanal der zu einem Wasserfall führt.
Nach 4 Tagen Ausspannen, brachen wir zu unserer allerletzten Etappe nach Barcelona auf. Uns war etwas bange zu Mute. Würden wir gleich den Weg zur Autovermietung auf dem Flughafen Barcelona finden, in diesem Strassenwirrwarr? Was wird wohl „Hertz“ zum Kratzer am Auto meinen? Wie kommen wir mit all unserem Gepäck ins Zentrum der Stadt? Werden wir ein bezahlbares Hotelzimmer ohne Vorreservierung finden? Alle unsere Bedenken waren umsonst und es lief alles wie am Schnürchen. Der Flughafen war gut gekennzeichnet, wenn auch immer unter einem anderen Symbol. Es gab sogar eine spezielle Spur für „Car Return“. Hertz nahm den Schaden zwar zur Kenntnis, ging aber nicht weiter darauf ein. Ein Shuttlebus brachte uns direkt ins Zentrum. Die Touristeninformation war sehr kooperativ und reservierte uns gleich ein Zimmer. Sogar Mehrtageskarten für die Metro konnten wir hier kaufen.
Nachdem wir unser Gepäck im Hotel deponiert und uns von den Strapazen erholt hatten, setzten wir uns erst einmal ins Café Zurich an der Plaza Catalunya und liessen die vibrierende Atmosphäre der Stadt auf uns einwirken.
Mit einem Touristenbus machten wir eine ca. vierstündige Stadtrundfahrt, um eine Übersicht über die 1,5 Millionenstadt zu gewinnen.
Die Stadt wurde einst auch von den Römern gegründet. Ihre Spuren sind jedoch fast verschwunden. Aber da wir eh gesättigt von römischer und maurischer Baukunst sind, kam uns das gerade recht. Wir erkannten bald, dass der Abschluss unserer Reise ein Leckerbissen sein wird.
Die Stadt war von jeher immer dem Fortschritt zu getan. In der Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Stadt aus allen Nähten platzte, wurden die Stadtmauern abgerissen und eine Erweiterung, rund um die Altstadt, das heutige Barri Gotic, wurde schematisch geplant. In den neuen Quartieren wurden viele Häuser im katalanischen Jugendstil (Modernisme) gebaut. Der Modernisme zeichnete sich durch seine Neigung zu geschmeidigen, fliessenden Linien und (für jene Zeit) gewagten Kombinationen wie Kacheln, Glas, Backstein, Eisen und Stahl aus.
Die Modernisten wurden jedoch auch von einer erstaunlichen Vielfalt anderer Stilrichtungen, wie Gotik, Islam, Renaissance, Romanik, Barock und Byzanz, beeinflusst. Ende des 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts prägte ein Genie von Architekt das Stadtbild: Antoni Gaudi. Heute bilden 7 seiner Werke in der Stadt ein Unesco Weltkulturerbe.
Einen Tag widmeten wir diesem Architekten. Erst besuchten wir das Wahrzeichen Barcelonas, Gaudis Kathedrale „Sagrada Familia“. Fast eine Stunde standen wir in einer Warteschlange, um dieses geniale Meisterwerk zu besichtigen. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist die Kirche im Bau.
Die Baukosten werden jeweils aus den Eintrittsgeldern finanziert. Immer wenn wieder etwas Geld zusammen ist, wird an einer Ecke, nach Gaudis Sinn, weitergebaut. Man rechnet, dass die Kirche ca. 2020 fertig gestellt sein wird. Die verschiedenen vermischten, und doch modern wirkenden Baustile faszinieren. Man könnte Stunden in dieser Kirche oder ausserhalb verbringen und immer sieht man wieder ein neues ausgefeiltes Detail.
Der Parque Güell ist ein weiteres Kunstwerk Gaudis. Graf Güell, ein stetiger Auftraggeber Gaudis, kaufte im Jahr 1900, damals noch ausserhalb der Stadt, ein Hügelgrundstück. Er wollte dort eine Minigartenstadt für Reiche schaffen. Das Projekt wurde 1914 aufgegeben, doch Gaudi hatte bis dahin auf seine unnachahmliche Weise, 3 km Wege, Strassen, Treppen, Viadukte,
einen Platz, sowie zwei Knusperhäuschen-Torpavillons gebaut.
Vom Eingang, bewacht von einem mit Mosaiksteinen verzierten Salamander, führen Treppen zur „Sala Hipostila“, einen Wald von 84 Steinsäulen, die ursprünglich als Markthalle gedacht war.
Auf dem Dach dieser Markthalle öffnet sich ein weiter Platz, der von der „Banc de Trencadis“ , einer gekachelten Sitzbank, umgeben ist.
Vom obersten Hügel dieses Parkes aus, geniesst man eine herrliche Aussicht über Barcelona, bis hin zum Meer.
Die Weltausstellung 1929 und die Olympiade 1992 haben viel dazu beigetragen, dass alte und verfallene Quartiere abgerissen, neubebaut oder renoviert wurden.
Auch im Hafen hat man sich auf die neuen Gegebenheiten ausgerichtet.
Immer mehr Kreuzfahrtschiffe legen hier an und Barcelona gehört zu den wichtigsten Häfen rund um das Mittelmeer.
-Wir besuchten das ehemalige Königsschloss mit seinem üppig grünen Garten. Das Schloss wird nicht mehr von der Königsfamilie benutzt. Heut sind dort ein Keramik- und Textilmuseum untergebracht. Im Keramikmuseum sind auch Werke von Miro und Picasso ausgestellt.
– liessen uns mit dem Funicolar
auf den Tibidabo, den ca. 500 m hohen Berg bei Barcelona, hinauf transportieren.
Nicht die zwei übereinander liegenden Kirchen, die nachts weitherum sichtbar sind, sind dort die Hauptattraktion,
sondern der Vergnügungspark. Der Park besteht schon seit ca. 100 Jahren und ist ein Gemisch von Nostalgie und High-Tech.
-Nachts um 21:00 h sahen wir den farbigen Wasserspielen des Font Magica de Monjuic.
Mit Musikbegleitung spritzt das Wasser aus den verschiedenen Fontainen, unterhalb des Palastes, der speziell für die Weltausstellung 1929 bebaut wurde.
– besuchten das “Poble espanol de Barcelona“ , ein Freilichtmuseum, ebenfalls im Parque Monjuic und ebenfalls für die Weltausstellung gebaut. Eigentlich sollte es nach der Ausstellung wieder abgebrochen werden. Es war aber das meist besuchte Gelände und blieb bis heute erhalten. Dort werden kunsthandwerkliche oder kulinarische Spezialitäten der verschiedenen Regionen Spaniens angeboten. Die Produkte werden in nachgebauten Häusern, wie sie in den verschiedenen Regionen üblich sind angeboten.
– bewunderten den Arc de Triomf
– lauschten dem munteren Gezwitscher der kleinen Papageien, die die Baumkronen des Parque de la Ciutadella bewohnen.
– liessen uns zu einer Shopping/Lookingtour im bekannten „El Corte Ingles“ hinreissen. Die letzten „Sommerhängerchen“ werden mit viel Rabatt verkauft, daneben sind bereits die ersten Vorboten des Herbstes, die elegante spanische Mode, ausgestellt.
– liessen uns per Lift auf das Dach der Stierkampfarena bringen.
– schlenderten durch das Quartier „Barri Gotic“, die Altstadt mit den engen Gassen und auf der „La Rambla“, Barcelonas Flanierstrasse.
– flitzten per Bus, Tram und Metro durch die Stadt.
100 km Radwege wurden durch Barcelona gebaut. An den verschiedensten Orten stehen Stationen mit Mietvelos, die die Einwohner mit einem Jahresabonnement, benutzen können.
Am Anfang unserer Reise erfreuten wir uns an den ersten blühenden Frühlingsblumen,
hier in Barcelona verlieren die Platanen bereits ihre ersten Blätter. Es ist Herbst geworden.
Während unseres Aufenthaltes in Barcelona erhielten wir zwei Mails von der Transportfirma, die unsere Räder nach Hause bringen sollte. Im ersten Mail teilten sie uns mit, dass der spanische Zoll den Transport nur genehmige, wenn wir eine Proformarechung, ausgestellt von einem Spanier und dessen Passkopie liefern würden. Auf unsere Antwort, es sollte doch möglich sein, unsere Schweizer Räder zurück in die Schweiz zu transportieren, kam dann im zweiten Mail die Nachricht, die Agentur in Algeciras, wo wir die Velos abgeliefert hatten, werde eine Proformarechnung ausstellen und werde eine Passkopie zur Verfügung stellen. Das mit der Proformarechnung hatten wir am 1. August, bei der Aufgabe unserer Velos, genau in dieser Agentur besprochen. Nun sind wir gespannt, was der Schweizer Zoll zu diesem Transport meint. Es würde uns nicht wundern, wenn wir für unsere Tour de Suisse Velos noch Zoll bezahlen müssten.
Pünktlich um 19:25 h verliessen wir Barcelona mit dem Euro-Night-Zug.
Am anderen Morgen, ebenso pünktlich, um 10:09 h kamen wir in Zürich HB an.
Nun ist unsere Reise zu Ende und wir sind um viele unbezahlbare Erfahrungen reicher geworden. Es wird trotz Kälte im April und Hitze im Juli/August (oder gerade deswegen) eine unvergessliche Zeit bleiben und hat Spass gemacht. Wir sind glücklich und dankbar, dass wir unseren Traum verwirklichen konnten und dass wir wieder gesund nach Hause zurückkehren können.
Unsere Tage waren ausgefüllt mit Velofahren, Strassen suchen, Unterkünften suchen, Duschen, Wäsche waschen und Fussmärschen zu den Sehenswürdigkeiten. Ausserdem nahm unser Blog reichlich Zeit in Anspruch. Jedoch die vielen positiven Reaktionen haben diesen Aufwand verdankt.
Alles was zu Hause zurück geblieben ist, war fern und weit weg.
Die Natur faszinierte uns. Vieles ist gekommen und plötzlich wieder verschwunden.
So der Kuckuck, der uns lange Zeit begleitete, die Störche zwischen Burgos und Leon. In Südportugal und Südspanien waren sie plötzlich wieder da. Die Möwen, die uns an einigen Orten am Meer frühmorgens mit ihrem Lärm weckten.
Die vielen Hunde, die uns jeweils hinter den Gartenzäunen ankeiften und anfletschten und die sich beinahe selbst an den Gartenzäunen erhängten vor Aufregung.
Einzig die Tauben waren uns auf der ganzen Reise treu. Ihr Gurren haben wir überall vernommen.
Auch auf der Speisekarte erschienen Spezialitäten und plötzlich waren sie wieder verschwunden.
Der Entscheid ein Auto zu mieten war das einzig Richtige. Die Fahrten über Land waren angenehm, die Städte mit der ewigen Parkplatzsuche stressten uns. Der Nachteil der Reise mit dem Auto war, dass Sehenswürdigkeiten Schlag auf Schlag auf uns einwirkten . Wir hatten am Schluss Mühe alles Gesehene richtig einzuordnen. Das Abenteuer-Feeling, der Kontakt zur Natur und zu den Menschen unterwegs, war weg. Im Auto hörten wir kein munteres Vogelgezwitscher, kein Grillengezirpe oder das Zischen einer Schlange.
Wenn es in den letzten drei Wochen wieder einmal in unseren Gliedern juckte und zuckte, waren wir uns einig, uns fehlen täglich 50 Velokilometer!
Wenn wir am Anfang gewusst hätten, was wir heute wissen, hätten wir einiges anders geplant. Tarifa, als südlichster Punkt Spaniens, war unser ehrgeiziges Ziel, aber es war schliesslich der Mühe nicht wert. Heute würden wir vielleicht unsere Räder in Sevilla für einige Tage einstellen und Andalusien per Auto entdecken, um anschliessend wieder mit dem Velo direkt ab Sevilla auf der Via de la Plata nordwärts fahren. Auf dieser Route wären wir wieder besser dokumentiert. Die Via de la Plata ist und bleibt ein Traum in unseren Hinterköpfen, den wir sicher in einem der nächsten Frühlinge ausleben werden.
Wenn wir jedem Bettler, Gaukler oder Strassenmusikanten einen Euro gespendet hätten, wäre unsere Reise bereits vor zwei Monaten aus finanziellen Gründen beendet gewesen.

Nun sind wir mit Sonne und Wärme aufgetankt. Wir hoffen, dass wir diese Energien bis in den Winter hinein speichern können.
Als Erinnerung bleiben uns nahezu 5000 Fotos, die während der Wintermonate ausgemistet, sortiert und bearbeitet werden müssen, bevor wir die nächste Reise planen. Diese geht (ohne Velo) nach China, wo wir unseren Sohn Oliver und seine Partnerin Lenka besuchen werden.